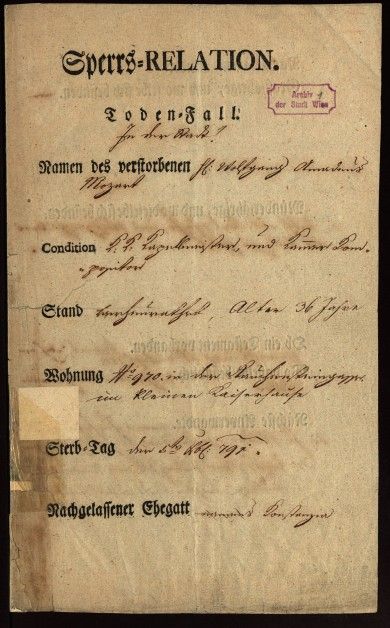Akt
Akten entstehen als Niederschlag der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit und sind somit prozessgenerierte Unterlagen. Der Akt (Lateinisch „acta“ – das Geschehene, die Handlung) ist die „Gesamtheit der analogen oder elektronischen Dokumente, die im Rahmen einer spezifischen Geschäftstätigkeit (z.B. in einer Behörde) entstehen und aufgrund eines Ordnungsmusters zusammengebracht, also formiert werden“.[1] Als grundlegende Einheit der Schriftgutverwaltung sollte der Akt alle Aufgaben und Entscheidungsprozesse abbilden, die zu seiner Entstehung geführt haben.
Durch die immer weiter verbreitete elektronische Datenverarbeitung entstehen zunehmend digitale Unterlagen, die in elektronischen Managementsystemen verwaltet werden. Elektronische Akten sind dementsprechend digitale Unterlagen der Verwaltung, deren Entstehungskontext über Metadaten dokumentiert ist. Die authentische Form ist elektronisch.
Serienakten und Sachakten
Akten werden grundsätzlich in Serienakten und Sachakten unterteilt. Serienakten gelten als die ältere Form der Aktenbildung und wurden seit dem 15. Jahrhundert angelegt. Sie entwickelten sich aus den [Amtsbuch|Amtsbuchregistraturen] heraus. Ausschlaggebend für die Ordnung der Akten war die chronologische Reihenfolge, auf den Inhalt wurde nicht geachtet. Eine Differenzierung erfolgte hauptsächlich durch Zeitschnitte.
Sachakten hingegen sind nach inhaltlichen Gesichtspunkten geordnet. Dabei wird versucht, alle Unterlagen zu einem bestimmten Sachbetreff zusammenzuführen, wobei dieser Sachbetreff für eine gezielte Suche sinnvoll und systematisch formuliert sein sollte. Diese Strukturen können durch Aktenpläne vorgegeben werden.
Aktenpläne
Für die Formierung von Akten ist ein nach Aufgabenbereichen gegliederter Aktenplan von zentraler Bedeutung. In Aktenplänen werden die Aufgaben einer Institution systematisch zusammengefasst und als Ordnungsrahmen für das Registrieren und Ordnen von Dokumenten verwendet.[2] Sie sind damit ausschließlich ein Ordnungsrahmen und kein Nachweis über das Vorhandensein des Schriftguts an sich. Aktenpläne können sowohl in analoger als auch digitaler Form vorhanden sein.
Literatur
- Akte. In: Terminologie der Archivwissenschaft. Archivschule Marburg [Stand: 26.11.2019]
- Friedrich Beck, Eckart Henning (Hg.), Die archivalischen Quellen. Mit einer Einführung in die Historischen Hilfswissenschaften. 5. Auflage. Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag 2012
- Holger Berwinkel, Robert Kretzschmar, Karsten Uhde (Hg.): Moderne Aktenkunde (=Veröffentlichungen der Archivschule Marburg 64). Marburg: Archivschule Marburg 2016
- Michael Hochedlinger: Aktenkunde. Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit. Wien: Böhlau Verlag 2009
- Robert Kretzschmar: Archivalische Quellenkunde im frühen 21. Jahrhundert. Ein „Kleines Fach“ mit großer Wirkung. In: Elisabeth Schöggl-Ernst, Thomas Stockinger, Jakob Wührer (Hg.). Die Zukunft der Vergangenheit in der Gegenwart. Archive als Leuchtfeuer im Informationszeitalter [=Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 71], Wien: Böhlau Verlag 2019, S. 41-55
- Robert Kretzschmar: Akten. In: Südwestdeutsche Archivalienkunde [Stand: 26.11.2019]
- Stefan Pätzold: Texte, Quellen, Archivalien. Geschichts-, hilfs- und archivwissenschaftliche Ansätze der Quellenkunde. In: Archivalische Zeitschrift 92 (2011), S. 351-374
Einzelnachweise
- ↑ Akte. In: Terminologie der Archivwissenschaft. Archivschule Marburg [Stand: 26.11.2019]
- ↑ Aktenplan. In: Terminologie der Archivwissenschaft. Archivschule Marburg [Stand: 26.11.2019]